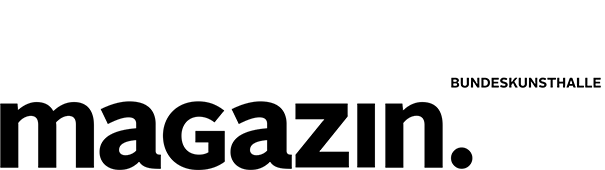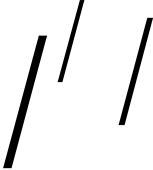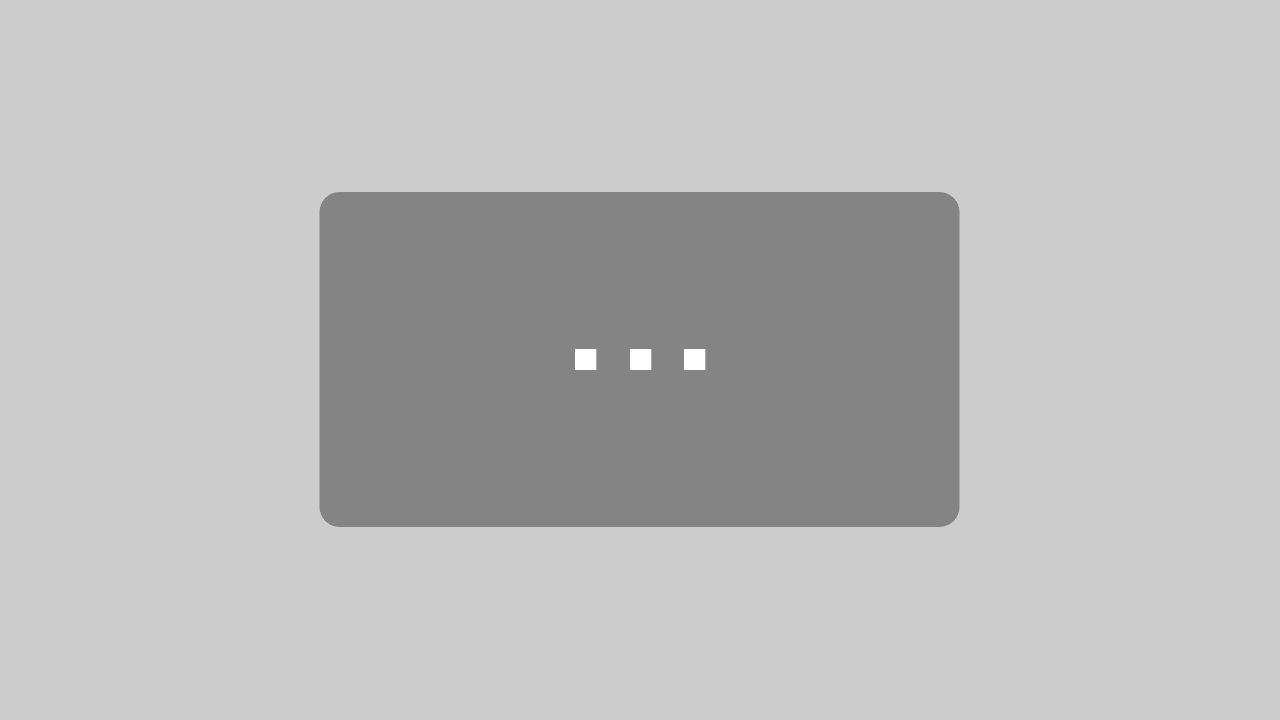von Wolfgang Willaschek
Prolog
Neulich in der Oper. In diesem Fall nicht wichtig, wann, wo, was. Während der Ouvertüre wird auf eine transparente Gaze in technischer Brillanz das Gesicht des Opernhelden gebeamt. Kurz darauf tauchen Bilder und Gestalten aus Träumen und Alträumen auf, gestochen scharf wie aus einem Hollywoodfilm. Dann fährt die Gaze nach oben. Das gesamte folgende Stück lang ruckeln Bühnenwägen hin und her, werden symbolhaft Gegenstände aus dem Schnürboden abgesenkt oder Styroporfelsen strapaziert. Nur eines geschieht leider nicht, eine Verbindung des hier gleichzeitig eingesetzten Zwei- mit dem Dreidimensionalen. In diesem Fall geht die Zeitreise zur Oper als multimedialem Gesamtkunstwerk mit sinnvoller Innovation gründlich schief. Das Fazit lautet in puncto Stück und Technik: „Die Oper ist tot!“.
Oper und Technik – Ergänzung oder Rivalität?
Der Auftrag an den Autor lautet, in Verbindung mit einer Ausstellung einen Essay zu schreiben über ein eigentlich unbeschreibliches Phänomen, weil man es, das Werk, vor allem „hören“ und „sehen“ muss. (Corona hat dies drastisch von neuem gelehrt.) Es taucht rasch eine sich über Jahrhunderte erstreckende und heute erst recht herausfordernde Frage auf: Unterstützt die Technik die Oper? Oder hebelt sie mit ihrem Tribut an die Erwartung und Schaulust des Publikums die Oper aus? Lassen sich der Idealismus des Kunstentwurfs und der unabdingbare Maschinen-Realismus für eine dem Werk entsprechende Umsetzung miteinander vereinen? Gibt es eine Lösung zwischen Innovation und Intervention? Wie überbrückt man die Spanne vom barocken „Deus ex machina“ (Mythos und Schnürboden) bis hin zu VR, AR, Unreal Engine, KI, was immer diese innovativen technischen Mittel für eine zeitgemäße Anwendung von Bühnentechnik im digitalen und multimedialen Zeitalter bedeuten mögen. Einen Sänger mit einer Videokamera zu filmen oder sich selbst filmen zu lassen, ist angesichts der Schnelllebigkeit des audiovisuellen Wandels heute schon eher ein alter Hut.
„Fanget an“ heißt es in Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. Im Unterschied zum gesprochenen Drama beginnt alles Technische im „Wort-Ton-Drama“ (der Begriff stammt von dem Bühnen-Raum-Visionär Adolphe Appia) bereits in jenem Augenblick, in dem der Dirigent den Orchestergraben betritt. Das Saallicht erlischt. Die Instrumentalisten im Graben benötigen Spiel-Licht, als appelliere ein „Audio“ zwangsläufig ans „Video“. Instrumenten-, erst recht Gesangs-Technik und Bühnenbild = Bühnenmaschinerie = Bühnen-Technik sind bereits eine Einheit, noch bevor man das gesungene Drama richtig hört oder das andere, das Szene-Spiel-Raum-Gesamtkunstwerk, richtig sieht. (Der Vorhang ist noch geschlossen, alles andere aber ist schon da…) Quod erat demonstrandum: „Es lebe die Oper!“ Schön und gut, aber zunächst gilt es doch einmal, Begriffliches zu klären.
Bühnentechnik
Nehmen Sie sich Zeit und Ihren Laptop oder das Handy und hören und sehen Sie sich, obwohl Sie sich in einem Essay befinden, Bühnentechnik live an – direkt, detailliert und mit Blick hinter die Kulissen, um die es geht. Entweder in „Vorgestellt: Die Bühnentechnik der Wiener Staatsoper“, alle Hintergründe erklärt von Ing. Peter Kozak, dem Technischen Direktor, oder in: „Was macht eigentlich die Bühnentechnik?“, in diesem Fall versiert eingeführt von Simon Pech, einem angehenden Bühnenmeister des Staatstheaters Stuttgart. Diese öffentlich-rechtlich zugängliche Methode in einem Essay zu empfehlen, ist weder Verlegenheit noch Ausrede, Marotte oder Platzsparend. Sie zeigt vielmehr einen anderen, in diesem Fall innovativ technischen Weg der Wissensvermittlung auf.
Oper
Zur Kernfrage: Was ist eigentlich Oper? „Die Geschichte weiß nichts von sich selbst… Aber manchmal überraschen uns Handlungen, die aus sicherstem Vorsatz bei hellstem Bewusstsein geschehen. Von solcher Art ist die Erfindung der Oper. Niemals ist eine mächtigere Kunstform auf künstlichere entstanden. Sie ist die letzte große Schöpfung der Renaissance, die Erbschaft, die diese in der Stunde ihres Unterganges dem Barock vermachte.“ (Richard Alewyn, Theatralische Gestalten, in: Probleme und Gestalten, Frankfurt am Main 1974, S. 13) Heureka! Einen Absatz später heißt es: „Dass mit der Oper eine neue szenische Kunst entsteht, die im Bühnenraum das optische Gegenstück erschließt; jenes Dekorationssystem, durch dessen Ufer sich die Klangmassen hindurchwälzen, getragen von singenden, tanzenden Menschen, und die festlichen Logenhäuser, die würdig sind, die akustische Brandung zu empfangen.“ (Alewyn, S.13) Voila, da haben wir diese untrennbare Einheit, das Spektakel als Gesamtkunstwerk: Oper als „Dekorationssystem“ und „akustische Brandung“ über die Jahrhunderte hinweg. Aber was heißt das in der Praxis? Jetzt brauchen wir eine Art Urknall für die Beziehung von Oper und Technik.
Opern-Technik: Eine Bühnenreich für ein Pferd…
„Man hörte das Werk mit viel Beifall und lobte es“, sagt Claudio Monteverdi, einer, wenn nicht der Gründervater der Oper, über die Uraufführung von Combattimento di Tancredi e Clorinda, was er selbst „den in Musik gesetzten Kampf des Tancredi mit Clorinda, beschrieben von Tasso“ nennt. Das Stück ist keine Oper, sondern ein seltsamer, 1638 im 8. Madrigalbuch Monteverdis abgedruckter Zwitter. Ein Testo = Erzähler entfaltet dabei ein Epos (Oper I = Geschichte = Hören und Zuhören). Dies handhabt er so suggestiv, dass die beiden kämpfenden Figuren bald darauf tatsächlich auftreten, ein Drama (Oper II = Szene, Bühne, Technik = Zusehen und Dabeisein). Clorinda, die Sarazenin, erscheint in einer Rüstung. Das muss ziemlich geklappert haben… Ihr Geliebter Tancredi, der Christen-Bekehrer, darf sie im Kampf nicht erkennen, sonst macht das tragische Ende keinen Sinn. Geliebter tötet Geliebte, merkt es aber zu spät. Tancredi soll bei der Uraufführung dieser Epos-Drama-Oper im Februar 1624 tatsächlich auf einem Pferd in den Aufführungssaal seines Gönners Signor Girolamo Mocenigo geritten sein. Was für eine technische Herausforderung! Monteverdi spricht in seinen Anweisungen möglicherweise von einem Holzpferd. Andererseits besitzt Mocenigo damals nachweislich eine Reitschule an seinem Venezianischen Hof… Vielleicht ist es sogar ein echtes Pferd. Aber hat der Saal- = Bühnenboden das ausgehalten? Das ist eine technische Herausforderung, die nur der Bühnenmeister lösen kann. Monteverdi tut sowieso, was er kann, um Notensatz und technische Anforderung zu vereinen. Man hört in seiner Musik das Pferd trappeln und trampeln, als würde damit die Foley-Art erfunden. Der Komponist als Geräuschemacher! So triumphiert in gewisser Weise die (komponierte) Technik über das szenische Ereignis…
Die Oper als Magie der Affekte ist von allem Anfang zugleich die Raum-Kunst künstlich hergestellter Effekte. Beides muss perfekt ausgeführt sein, das Technische dabei bei aller Präzision und Perfektion so unscheinbar wie nur möglich. Ein Hoch auf den Inspizienten, der Abend für Abend, unsichtbar für die Zuschauerinnen und Zuschauer, an seinem Pult exakt an der Demarkationslinie zwischen Illusion und Machbarkeit sitzt. Je unsichtbarer er mit seinem Handwerk agiert, desto wirkungsvoller und überzeugender gerät die Illusion.
Geschichten aus der Geschichte
Zwei Empfehlungen seien aufgrund des zwangsläufigen Platzmangels in einem Essay gestattet, will man in dieser versuchten Historie einer Art von „Hassliebe“ zwischen Oper und Technik so spannend wie in einem Krimi serviert bekommen: Leo Karl Gerhartz, Oper – Aspekte der Gattung, Regensburg 1983. Und: Klaus Theweleit, Buch der Könige – Band 1 Orpheus und Eurydike, Basel 1988. In beiden facettenreichen Schilderungen gibt es kaum einen Bericht zum Abenteuer Oper ohne dessen siamesischen Zwilling, die Abhängigkeit, ja Anhänglichkeit der Bühnenkunst von ihrer technischen Realisierung. Aber noch einmal zurück zu Claudio Monteverdi und zum eigentlichen Quantensprung: vom höfischen Zeremoniell zur öffentlichen Demonstration. Der Komponist geht, weil es damals wie heute nicht leicht ist, mit Oligarchen zurechtzukommen, mit fortgeschrittenem Alter vom auf Machtfülle gepolten Herzoghof in Mantua nach Venedig zu den dort seit etwa 1620 existierenden zahlreichen Opernhäusern. Das neue bürgerliche Publikum kommt sicherlich nicht in erster Linie wegen Mythos oder musikalischer Reformen ins Theater, sondern wegen des Spektakels einer Multimediaaufführung (das kann man ruhig so sagen) und wegen der Frage: Ist es glaubhaft, daher magisch (oder umgekehrt), wenn das Schiff der Phäaken an der Küste Ithakas landet? Und kurz darauf der Held in den Palast marschiert? Denn offene Verwandlungen gehören damals zum letzten Schrei. Auch da ist der Komponist wieder klüger, selbst im technischen Sinn. Er zwingt die Streicher im Orchester so leise zu spielen, dass man glaubt, das Schiff (es macht ja eigentlich Lärm, selbst ohne Motor) könne so leise am Ufer anlegen, dass Odysseus noch eine Weile weiterschläft, einem anderen Traum erlegen, aus anderen Welten kommend. Da schweigt sogar die Technik. Leider weiß man bis heute nicht genau, wo 1640 diese Uraufführung von Il ritorno d‘ Ulisse in patria (Die Heimkehr des Odysseus ins Vaterland) stattfand: im Teatro Santi Giovanni e Paolo oder im San Cassiano. Es gibt in Venedig damals einfach zu viele davon. Und vor allem kommen da die Götter, Helden und Allegorien aus den Maschinen. Und es gibt viele Göttinnen und Götter.
Technik-Geschichte im Zeitraffer
Wolfgang Amadeus Mozart verwandelt 1780/81 in seinem Dramma per musica Idomeneo den Deus ex machina, Zwitter-Gott aus Inhalt und Technik, in „La voce“, in die Stimme der Aufklärung, die bewusst selbst die Technik humanisiert. Da ist der Weg nicht mehr weit zu Carl Maria von Webers Romantischer Oper Oberon oder der Schwur des Elfenkönigs, bei der das kompositorisch einmalige Aufhellen des Himmels nach wütendem Sturm bei der Uraufführung 1826 mit einer Auflicht-Projektion auf einen mit unterschiedlichen Farbtönen bemalten Wandelprospekt realisiert wird, fast schon weltausstellungsgemäß – die erste folgt 25 Jahre später. Damit landet man beinahe schon bei Richard Wagner, über dessen Manie und Obsession, lieber mit Technikern zu tüfteln als mit Kunstversierten zu debattieren (es sei denn, es ging um´s Geld) man einen eigenen Essay „Oper und Technik“ schreiben könnte.
Aber, halt! Wenn Bühne und Technik damals im Aufbruchszeitalter zusammenkommen, kann man an Ludwig II., König von Bayern, nicht vorbei. Für eine 1868 in München angesetzte „neu inscenierte Oper Oberon“ erlässt der König höchstpersönlich zwölf Vorschriften und allesamt sind bühnentechnischer Natur. Unter anderem zählen dazu „Garten mit speienden Schwänen, besseren Flugmaschinen, reichere Rittercostüme, die Wiederkehr des Mondes“ und vor allem: „Das Schiff soll kleiner oder größer erscheinen“, und die Protagonisten hätten sich im Sturm am Mast festzuhalten. Irgendwie wird man in der Oper von Monteverdi an diese Bühnenschiffe nicht mehr los.
Es kommt darauf an, wie realistisch oder unrealistisch, womit wir beim Visionär Adolphe Appia sind, den Arturo Toscanini 1923 an die Mailänder Scala einlädt, damit er Richard Wagners Tristan und Isolde realisiert, eine Herausforderung besonderer Art, um Appias zuvor entwickelte Revolutionen vom Bühnenbild über das Licht bis zur rhythmischen Szenengestaltung tatsächlich in eine geschlossene Inszenierung zu übertragen. Appia schlägt vor, die Bühne des ersten Aktes zweizuteilen, in eine reale Schiffswelt und in einen Schlupfwinkel für Isolde. Er plädiert dabei vor allem für Einfachheit. Und schon wären wir erneut per Schiff in der Moderne gelandet. Wahrlich ein Zeit- und Quantensprung: Daher sei vorgeschlagen (trotz inzwischen unendlich vieler Google-Einträge dazu), die Kristallisationsmomente der atemberaubenden Historie „Oper und Bühnenbild-Technik“ als eigene Spurensuche in einem Opernlexikon nachzuschlagen: Elisabeth Schmierer, Hrsg., Lexikon der Oper, Regensburg 2002, S. 244-251. Die in diesem Essay nicht exemplarischen, sondern bewusst wegen der Unvergleichbarkeit gewählten Beispiele zur evolutionären technischen Entwicklung (kein technischer Fortschritt ohne künstlerische Weiterentwicklung und umgekehrt) zielen im Kern auf etwas Anderes. Nämlich darauf, dass einzig die Bühnenpraxis erweisen kann, wie und was es mit diesen siamesischen Zwillingen Technik und Oper auf sich hat, bei allen schon in den Worten enthaltenen faszinierenden Spiegelbildlichkeiten: Kompositions-Technik und Bühnenbild-Ästhetik. Da sucht das eine stets das andere: die Kreativität die Praxis, die Praxis die Illusion: Er-, Auf- und Verklärung.
Mitten aus der dramaturgischen Praxis heraus
Der Reiz, sich in diesem Essay auf die Suche nach der Gratwanderung Oper und-mit-gegen Technik zu begeben, hat wesentlich mit zwei Leben zu tun, mit meinen zwei Leben. Einem ersten als Produktionsdramaturg im Musiktheater, vorrangig mit Regisseuren und bei Festivals (1982-2008) und einem zweiten als Leiter von Dramaturgie und Produktionslabor der Medientechnik an der HAW Hamburg (2007 – 2022). Zunächst zum ersten Leben…
Ohne die Technik(er) geht es nicht
Ein Schlüsselerlebnis, was in der Bühnenpraxis funktionieren muss, damit aus dem „oder“ zwischen Oper und Technik ein „und“ wird, hat mit einem Konzeptionsgespräch an der Oper Leipzig im Februar 1992 zu tun. Nikolaus Lehnhoff, Regisseur einer Neuinszenierung von Richard Straussʼ Elektra unter der Intendanz von Udo Zimmermann, staunt nur kurz, als man ihm sagt, Einführungen würden hier zunächst mit der kompletten technischen Mannschaft abgehalten und dann erst mit den Darstellern und dem szenischen Personal. Heute ist schwer nachvollziehbar, wie der Dramaturg damals bestaunt wurde, weil er seine Notizen in einen mitgebrachten Computer tippt. Als die Besprechung zu Ende ist, sagt ein Bühnentechniker mit skeptischem Blick auf den Bildschirm in hier leider nicht wiederzugebendem Sächsisch: „Na, dann schreib mal schön auf, wie der sich drehende Kubus, den euch der Bühnenbildner Gottfried Pilz vor die Füße geworfen hat, tatsächlich funktionieren soll…“ Und wirklich: “Elektras Haus“ entpuppt sich während der Proben als technisch nicht leicht zu händelndes Monstrum. Doch ohne jenes in den ersten Augenblicken gewonnene Vertrauen der Technik zum szenischen Team hätte das Ganze nicht funktioniert. (Als Dramaturg sollte man bei solcher Gelegenheit vielleicht nicht gleich Hugo von Hoffmannsthal zitieren: „Theaterdekorationen sind allegorisch.“)
Diskurs und Diskrepanz von Gebautem und Geschautem
Im Sommer 2003 inszenierte Stefan Herheim im Kleinen Festspielhaus in Salzburg Die Entführung aus dem Serail von Johann Gottlieb Stephanie und Wolfgang Amadeus Mozart. Dramaturgische Recherche: Mozart flieht 1780 Hals über Kopf von Salzburg nach Wien. Er verliebt sich in Konstanze Weber, deren Mutter die Verbindung missbilligt. Freunde nennen diese Abkehr vom Haus am Peter, in dem die Webers wohnen, „die Entführung aus dem Auge Gottes“. Erklingt in der Salzburger Inszenierung die Ouvertüre, ist der Vorhang bereits geöffnet. Man sieht am Ende einer Bühnenschräge drei große Fenster, vielleicht sind es Türen. Dahinter hört man Babygeschrei, sieht ineinander sich verhakende Hände, schließlich eine riesige projizierte Rose. Videoeffekte als Paradies-Bilder, vor 20 Jahren noch nicht Bestandteil (fast) jeder Aufführung. Im langsamen Teil der Ouvertüre erscheinen ein nackter Mann und eine nackte Frau und betreten alsbald die Welt, technisch gesehen die Bühne. Kurz darauf stehen sie, jeder für sich, in einem Scheinwerferkegel. Es existiert kein Opern-Raum ohne das diffuse Spiel von Licht und Schatten, keine Technik ohne subtil eingesetzte Scheinwerfer.
Rasch entpuppt sich das Haus auf der Bühne als multifunktionale symmetrische Konstruktion zweier gegeneinander wie ineinander fahrender Drehscheiben. Türen und Fenster können jederzeit entschwinden und wiederkehren in einem Traum-Trauma-Spiel, in dem jede und jeder die ewige Liebe finden will, Gott sein möchte oder auch gern der Teufel. (Jedenfalls eine Stimme, auf die man hört: Wir sind ja in der Oper). Diskutieren dies jemals der Regisseur, der Bühnen- und Kostümbildner Gottfried Pilz, der Dramaturg mit der Technik in solcher Form? Da gibt es also ein Haus, das hat vielleicht mit Mozarts Lebensgeschichte zu tun, und das ist jetzt Aufhänger und Auslöser der Geschichte. (Was ohnehin so nicht gemeint ist…) Nein, so wenig wird darüber gesprochen wie darüber, warum irgendwann klar ist, die Sprechrolle des Bassa Selim dieses Mal ganz zu streichen, da alle anderen Figuren ohnehin andauernd dieser Bassa sein können und wollen. (Da war was los im Salzburgischen.) Stattdessen gibt es zwangsläufig intensive und lange Gespräche, wie exakt die Bühnenteile zu bewegen seien, wann die Unterbühne zu öffnen ist, damit Teufels- und Himmelswerk auftauchen, wie in einem magischen Kasperletheater (so etwas lieben Bühnentechniker). Und wenn im letzten Aufzug das hohe Paar per Video auf dem fliegenden Teppich davon schwebt oder in Windeseile auf die Tapeten des ersehnten Liebes-Tod-und-Teufel-Hauses eine Salzburg-Kulisse per Trick gebeamt wird, beeindruckt das erst recht die Techniker, die es zu realisieren haben. Wieviel Mühe kostet, dass eine mehr als vier Meter in die Tiefe gehende Versenkung nicht zu einer gefährlichen Falle für die Darstellerinnen und Darsteller wird, ist eine andere Geschichte. Aber auch sie gehört zum Wesentlichen im Opern-Technik-Kosmos. Jedes Bühnengeschehen ist eine Herausforderung an die optimale technische Sicherheit. In der Oper heißt das: auf Leben und Tod. Für die Technik bedeutet es höchste Verantwortung für die menschliche Unversehrtheit.
____
Autor: Wolfgang Willaschek
Im zweiten Teil des Artikels spricht Wolfgang Willaschek mit Gesprächspartner*innen von der HAW Hamburg. Lukas Mattern, Johannes Schmidt und Christina Becker haben mit der Bühnentechnik der Oper unmittelbare Erfahrungen sammeln können und beantworten die Frage, wie es gelingt, neueste Errungenschaften in etablierten Apparaten und Hierarchien zu verankern.